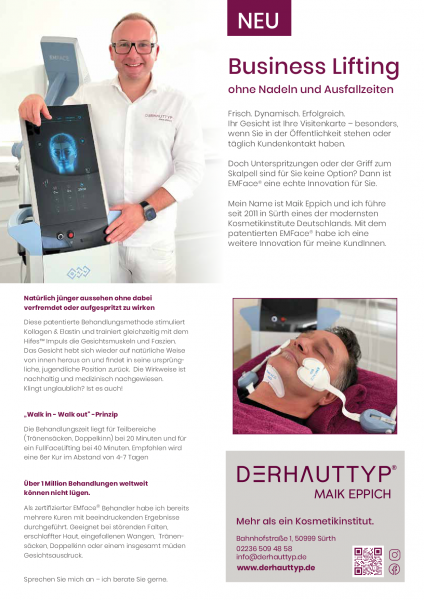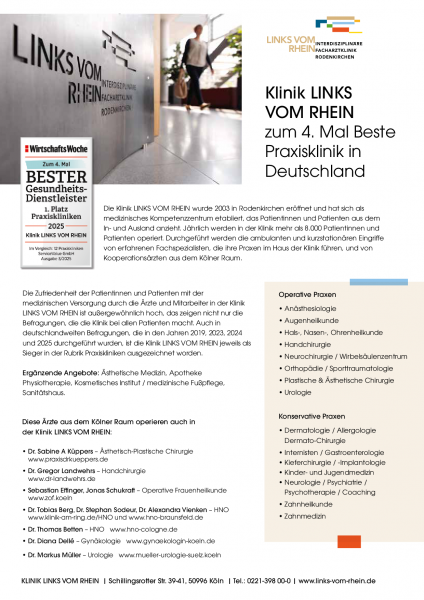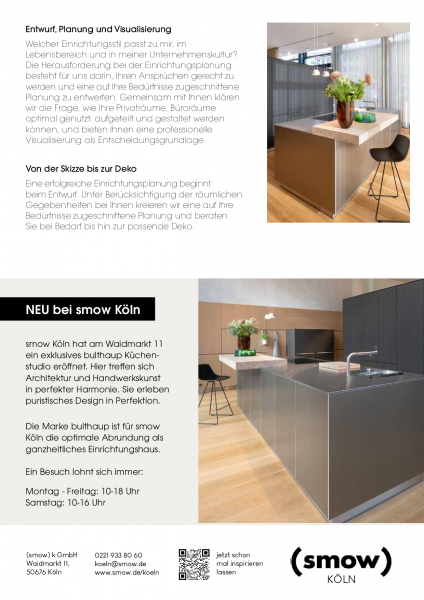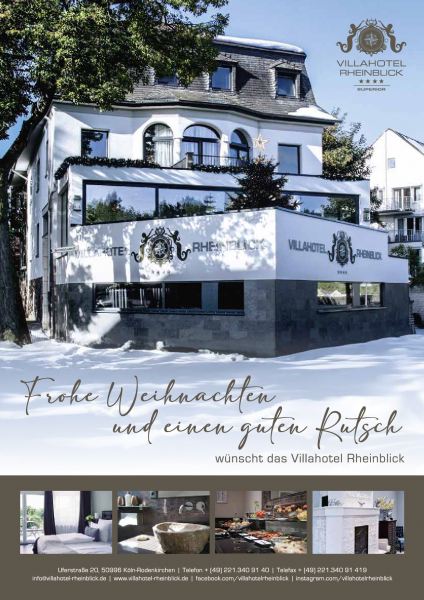Es fehlen schlichtweg: Wohnungen
Es fehlen schlichtweg: Wohnungen
Im Kölner Süden, einem der dynamisch wachsenden Wohnräume der Stadt, verschärft sich die Wohnsituation zunehmend – besonders für Familien und Menschen mit mittlerem Einkommen. Der bundesweite Rückgang im Wohnungsbau spiegelt sich hier besonders deutlich wider: Während Bundeskanzler Friedrich Merz am 21. Mai 2025 beim Tag der Bauindustrie in Berlin forderte, dass „wer normal verdient, der muss ein normales Wohneigentum erwerben können“, zeigt die Realität in Köln ein gegenteiliges Bild. Merz kritisierte zurecht, dass sich Menschen mit durchschnittlichem Einkommen in deutschen Großstädten kaum noch Wohneigentum leisten können. Als Hauptgründe nannte er hohe Baukosten, langwierige Genehmigungsverfahren und fehlendes Bauland. Die Bundesregierung kündigte daher Maßnahmen für einfacheres, schnelleres und günstigeres Bauen an. Wie das umzusetzen ist, bleibt fraglich. Wie ernst die Lage ist, zeigt nämlich ein Blick auf die Zahlen: Laut Statistischem Bundesamt wurden 2024 bundesweit nur noch 251.900 Wohnungen fertiggestellt – ein Rückgang von 14,4 % gegenüber dem Vorjahr. Besonders stark betroffen sind private Bauherren, insbesondere beim Bau von Ein- und Zweifamilienhäusern, der um 22,1 % bzw. 26,2 % eingebrochen ist. In Köln ist der Absturz noch drastischer: Im Jahr 2024 wurden lediglich 1.819 neue Wohnungen fertiggestellt, ein Minus von 48,5 % im Vergleich zu den 3.533 im Jahr zuvor. Das ist der niedrigste Stand seit über drei Jahrzehnten – seit 1990. Auch im Kölner Süden, etwa in den Stadtteilen Rodenkirchen, Bayenthal, Zollstock oder Raderthal, bleiben viele Flächen ungenutzt oder Projekte verzögern sich über Jahre. Zwar wurden stadtweit 2931 Wohnungen genehmigt, sind es 8,7 % weniger als 2023. Dazu kommt der Bauüberhang – also Wohnungen mit Genehmigung, die aber bisher nicht fertig – stieg auf einen historischen Höchstwert von 10.308 Wohnungen. Köln bleibt damit weit hinter seinem selbst gesetzten Ziel zurück, jährlich 6.000 bis 7.000 Wohnungen zu bauen. Die Entwicklung markiert nicht nur einen statistischen Tiefpunkt, sondern auch ein strukturelles Problem im städtischen Wohnungsbau.